Die Anfänge
Wann genau die erste Kirche in Sottrum erbaut wurde lässt sich nicht feststellen. Eventuell hat vor der ersten steinernen Kirche aber bereits ein Holzgebäude an der Stelle gestanden, das wiederum vermutlich an der Stelle eines zuvor heidnisch-germanischen Kultortes erbaut wurde, wie es zur Zeit der Christianisierung üblich war.
Wissenschaftliche Datierung
Dendrochronologische Befunde (2009)
1288
Fällung des ersten Deckenbalkens im Kirchenturm
1292
Fällung des zweiten Deckenbalkens im Kirchenturm
Ca. 1290
Baubeginn des Turmes
(unter Berücksichtigung der seinerzeit üblichen Ablagerung von Bauholz)
Dabei wurde die östliche Wand des Turms auf eine zuvor bestehende Wand aufgesetzt was deutlich am Mauerwerk zu erkennen ist. Es ist also davon auszugehen, dass bereits zuvor eine Kirche bestand.
Baugeschichte
Romanisches Kirchenschiff (vor 1290)
Zu diesem älteren Bauabschnitt, auf dem der Turm aufsetzt, gehören auch noch Teile der bestehenden Nord- und Südwand.
Abmessungen des romanischen Kirchenschiffes:
- Länge: ca. 16 m (Nord-Süd-Strecke)
- Breite: ca. 8,5 m
- Eingang: Westseite durch rundbogige Tür (heute noch vorhanden)
- Wandhöhe: niedriger als heute
Die Ostwand existiert nicht mehr, da um 1380 der Chor angebaut wurde. Wie die Ostwand zuvor ausgebildet war und ob eventuell eine Apsis (halbkreisförmiger Anbau) vorhanden war, lässt sich ohne weitere archäologische Untersuchungen nicht feststellen.
Chorerweiterung (um 1380)
Ob diese Kirchenerweiterung auf den Besitzwechsel von den Wohldenberger Grafen hin zum Bischof von Hildesheim zurückzuführen ist, ist Spekulation – diese zeitliche Auffälligkeit sei aber trotzdem erwähnt.
Mittelalterliche Ausschmückung (um 1420)
Um 1420 gab es größere Baumaßnahmen am Dachtragwerk des Kirchenschiffes, das sich durch Altersbestimmung der Balken und die Einbausituation belegen lässt. Vermutlich stammen aus dieser Zeit auch die mittelalterlichen Wandmalereien, von denen heute ein Teilbereich an der Innenseite der Südwand freigelegt und restauriert zu betrachten ist.
Weitere historische Baumaßnahmen
Turmdach-Arbeiten
Arbeiten am Turmdach wurden durchgeführt, in deren Zusammenhang auch der Abschlussstein des Südgiebels neu gesetzt wurde, der diese Jahreszahl trägt.
Gewölbe-Abriss nach dem 30-jährigen Krieg
Nach schriftlichen Überlieferungen wurde kurz nach dem 30-jährigen Krieg das Gewölbe über dem Chor wegen Baufälligkeit abgerissen. In diesem Zusammenhang mussten wieder Arbeiten und Änderungen am Dachstuhl des Schiffes durchgeführt werden.
Barocker Umbau
In der Mitte des 18. Jahrhunderts erfolgte der barocke Umbau des Innenbereichs der Kirche.
Moderne Sanierung
Aufgrund von Feuchte- und Holzwurmschäden wurde das Dach des Kirchenschiffes sowie die Lehmdecke erneuert.
Türrestaurierung
Die vermutlich aus dem Jahr 1863 stammende Kirchentür wurde restauriert.
Die Glocken

Die große Läuteglocke aus dem Jahr 1526
Große Läuteglocke (1526)
Lateinische Inschrift:
Anno dni MCCCCCXXVI
Vivos voco – defunctos plango – daemones fugo – fulgura frango – vocor Maria
Deutsche Übersetzung:
Im Jahre des Herrn 1526, die Lebenden rufe ich – die Toten beklage ich – die Dämonen vertreibe ich – die Blitze breche ich – Maria heiße ich
Bildschmuck:
- Madonna
- Heiliger Dionysius (erster Bischof von Paris, Märtyrertod 285)

Die kleine Läuteglocke aus dem Jahr 1797
Kleine Läuteglocke (1797)
Kriegsgeschichte:
Diese Glocke wurde sowohl im ersten als auch im zweiten Weltkrieg ausgehoben und musste zu geplanten Kriegszwecken abgegeben werden. Beide Male kam sie aber unversehrt wieder zurück.
Auf ihr ist noch heute die aus Kriegszeiten stammende Beschriftung zu erkennen, die die Glocke als sog. B-Glocke klassifizierte.
Stählerne Schlagglocke (1919)
Ersatz für Kriegsverlust:
Die ursprüngliche Glocke musste im 1. Weltkrieg abgegeben werden und kam leider nicht zurück. Der Ersatz wurde von der Glockengießerei Weule in Bockenem gefertigt und kostete seinerzeit 565 Mark.
Altar und Innenraum
Der Altar (um 1745)
Der Altar stammt vermutlich aus dem Jahr 1745, zumindest trägt das heutige Altarkreuz, das früher an der Kanzel angebracht war, diese Jahreszahl. Ursprünglich war die Kanzel, die heute neben dem Altar steht, oberhalb des Altartisches in den Altar eingebunden.
Bretterdecke
Zeitlich nach dem Altar wurde die Bretterdecke erstellt und im barocken Stil bemalt. Nachdem 1925 und 1961 die Decke schon einmal restauriert und dabei übermalt wurde, wurde sie im Zuge der Kirchdacherneuerung 2008/09 noch einmal restauriert, um die ursprüngliche Malerei wieder zum Vorschein zu bringen.
Details zur Restaurierung:
Wengerstiftung - Deckenrestaurierung
Altarraum um 1910er
(Foto: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Taufengel (1749)
Dem Kirchbuch ist zu entnehmen, dass im Juni 1749 das erste Kind aus dem neuen Taufengel getauft wurde. Dort ist vermerkt: "Dies Kind ist das Erste, das Bey den Engel unserer Kirchen getauffet ist". Mit dem Abschluss der Kirchendach- und -deckensanierung 2009 wurde der Taufengel wieder im Altarraum montiert und in Betrieb genommen.
Taufstein (1883)
Der Taufengel wurde 1883, wohl zum 400. Geburtstag von Martin Luther, durch den angeschafften Taufstein verdrängt. Der Taufstein wurde 2009 in den Raum unter die Empore versetzt und wird seitdem nicht mehr genutzt.
Kronleuchter (1787)
Der aus Messing gefertigte Kronleuchter wurde 1787 zur Erinnerung an einen Verstorbenen gestiftet.
Orgel (1882/1926)
Die heutige Orgel stammt aus dem Jahr 1882, wobei die Orgelpfeifen 1917 im 1. Weltkrieg eingezogen und eingeschmolzen wurden. Sie wurden 1926 durch die jetzigen ersetzt. Schon vor 1882 verfügte die Kirche über eine Orgel, die unter Pastor Hoffmann begonnen und 1734 vollendet wurde.
Kirchhof
...die Kirche ist, auch abgesehen von der größtenteils trotz mancher Beeinträchtigung durch neue Arbeiten sehr wertvollen inneren Ausstattung, auch im Äußeren von ungewöhnlich reizvoller Eigenart und ein hochwertiges heimatliches Baudenkmal, das monumental und malerisch zugleich ist. Sie bedarf deshalb sorgsamen Schutzes gegen jede Beeinträchtigung ... das überaus reizvolle Gesamtbild von Kirche und Kirchenplatz mit der schlichten, niedrigen Einfriedungsmauer an der Straße, der mächtigen alten Linde vor der Kirche und der ruhigen Grünfläche rings um sie ist eines der schönsten mir bekannten heimatlichen Bilder in weitem Umkreis...
Oberreg.- und Oberbaurat Gensel - Reisebericht 1941
Der Kirchhof ist auch noch heute geprägt von der mehrere Jahrhunderte alten Linde und der alten Sandsteinmauer an der Wasserstraße. Der Kirchhof war früher einmal Friedhof, wurde aber wahrscheinlich zwischen 1860 und 1870 an den heutigen Platz neben dem katholischen Friedhof an die Sottrumer Straße verlagert.
Beim Bau des Lutherhauses 1955 ist man auf Überreste von Gräbern gestoßen. Die Rasenfläche südlich des Kirchenschiffes war früher Schulhof der angrenzenden evangelischen Schule und später Spielplatz.
Auszüge aus der Chronik von Ernst Jahn (1952)
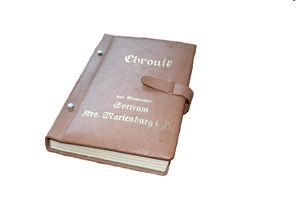
Chronik von Sottrum von Ernst Jahn
Im Folgenden geben wir Auszüge aus der Chronik von Lehrer Ernst Jahn wieder, die er ab Sommer 1952 verfasst hat. Hinweis: Die Baugeschichte der Kirche wurde von E. Jahn anders interpretiert als in der obigen wissenschaftlichen Darstellung, die in erster Linie auf der Ausarbeitung von Thilo Saueressig (Amt für Bau- und Kunstpflage Hildesheim) basiert.
Das Lutherhaus (1955)
Die Notwendigkeit, ein eigenes Gemeindehaus zu besitzen, hatte sich schon lange herausgestellt. Bis dahin wurden Veranstaltungen der Kirche (Jugendabende, Kirchenchor-Übungsabende und Zusammenkünfte der Frauenhilfe) in der linken Stube des Bauern Otto Bergmann Nr. 42 (jetzt Im Winkel 4) durchgeführt.
Begeistert griff die evangelische Jugend zum Spaten und half ausschachten. Am 19. Juni 1955 am Tage der Kirchenvisitation durch Superintendent Grotjahn, Bockenem, wurde die Grundsteinlegung feierlich begangen.

Grundsteinlegung zum evangelischen Gemeindehaus 1955
Nach Superintendent Grotjahn vollzog Pastor Birth die drei Hammerschläge
Die Friedhofskapelle (1967)
Der Plan, eine Friedhofskapelle zu errichten bestand schon lange. Aber erst die Klärung der Grundstücksfrage gab im letzten Jahr die Entscheidung. Man einigte sich auf ein Grundstück, das je zur Hälfte der Klosterkammer bzw. der evangelischen Kirchengemeinde gehörte, so dass die Kapelle auf der Grenze der beiden Friedhöfe gebaut wurde.
Im August 1966 wurde mit den Arbeiten begonnen, deren Kosten im Voranschlag auf 50.000 DM berechnet waren. Bauträger war die politische Gemeinde.
Bar gespendet waren bis zum Einweihungstag 11.018 DM. Verschönert wurde die Feier durch Darbietungen des Posaunenchors unter Leitung von Fritz Engwicht und des Gesangvereins unter Leitung von Karl Reuter.

Einweihung der Friedhofskapelle am 26. Februar 1967
Viele halfen durch großzügige Spenden
Quellenangaben
Hauptquellen:
- Thilo Saueressig: Amt für Bau- und Kunstpflege Hildesheim der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Dendrochronologische Baualtersbestimmung / Baugeschichte der Kirche, 2009
- Ernst Jahn: Chronik der Gemeinde Sottrum, 1952
Weitere Quellen:
- Fritz Garbe: Rings um den Königsberg, Gebr. Gerstenberg Hildesheim, 1954
- Manfred Binder: Sottrum, Ortssippenbuch, Auszug aus den evangelischen Kirchenbüchern, Papierfliegerverlang Clausthal-Zellerfeld, 2013
